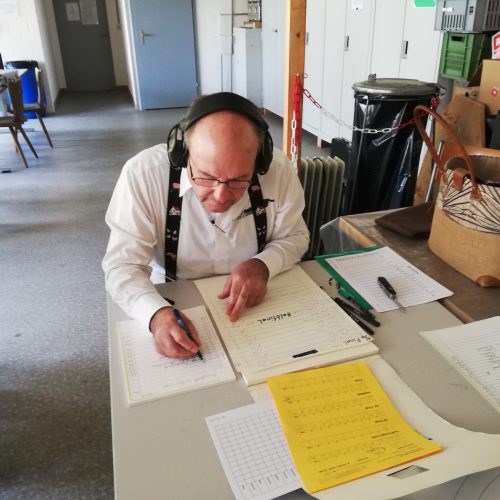Allen Vereinen sowie allen Schützinnen und Schützen, die sich in den vergangenen Wochen für ein Nein zum Waffengesetz eingesetzt haben, danken wir ganz herzlich. Die Plakatierung, das Schreiben von Leserbriefen, das Verteilen von Flyern und das Inserieren in Lokal- und Dorfzeitungen sind sehr wertvoll.
Nun beginnt aber die «heisse Phase» des Abstimmungskampfes und wir erwarten nochmals vollen Einsatz. Bringen wir also möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an die Urne bzw. an den Briefkasten, die uns unterstützen. Jeder hat die Pflicht und die Gelegenheit, in seinem Umfeld mehrere Nein-Stimmen zu gewinnen, sei es in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, bei Vereinskollegen in anderen Vereinen oder bei Arbeitskollegen.
Die wichtigsten Argumente gegen das neue Waffengesetz für uns Schützen sind:
– Alle Sturmgewehre 57 und 90, die nicht direkt von der Militärverwaltung übernommen wurden, werden verboten. Fast 80% der Schützinnen und Schützen schiessen mit solchen Sturmgewehren und wären somit vom Verbot betroffen.
– Es ist nicht so, wie vielerorts behauptet wird, dass sich für Schützen nichts ändere und es nur ein kleiner administrativer Mehraufwand sei. Es ist sehr wohl eine Änderung, wenn 80% der Schützen plötzlich eine verbotene Waffe haben.
– Wie lange uns Sportschützen die Ausnahmebewilligungen gewährt werden, ist sehr unsicher, weil der Art. 17 der EU-Waffenrichtlinie alle fünf Jahre eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung der Gesetzgebung fordert.
– Es ist kein Schützenrecht, sondern ein Bürgerrecht gefährdet. Wir Schützen wollen keine privilegierte Gruppe mit einer Ausnahmebewilligung sein, sondern wir wollen normale Bürger mit dem Recht auf privaten Waffenbesitz sein.
– Bereits seit 2008 gilt die Waffenerwerbsscheinpflicht für Sturmgewehre und Pistolen auch beim Verkauf unter Privaten. Damit werden die Waffen schon heute laufend registriert.
– Schengen ist nicht in Gefahr! Gemäss Botschaft des Bundesrats zu Schengen/Dublin von 2004 sind «im Falle der Nichtübernahme einer Weiterentwicklung die Vertragsparteien [also die Schweiz und die EU] verpflichtet, nach pragmatischen Lösungen zu suchen. Im äussersten Fall hätte die Ablehnung der Übernahme eines neuen Erlasses die Kündigung der Abkommen zur Folge». Im Normalfall wird das Abkommen also nicht gekündigt. Würde der viel zitierte Automatismus wirklich stimmen, so hätte die Schweiz der EU damals einen «Blankocheck» ausgestellt.